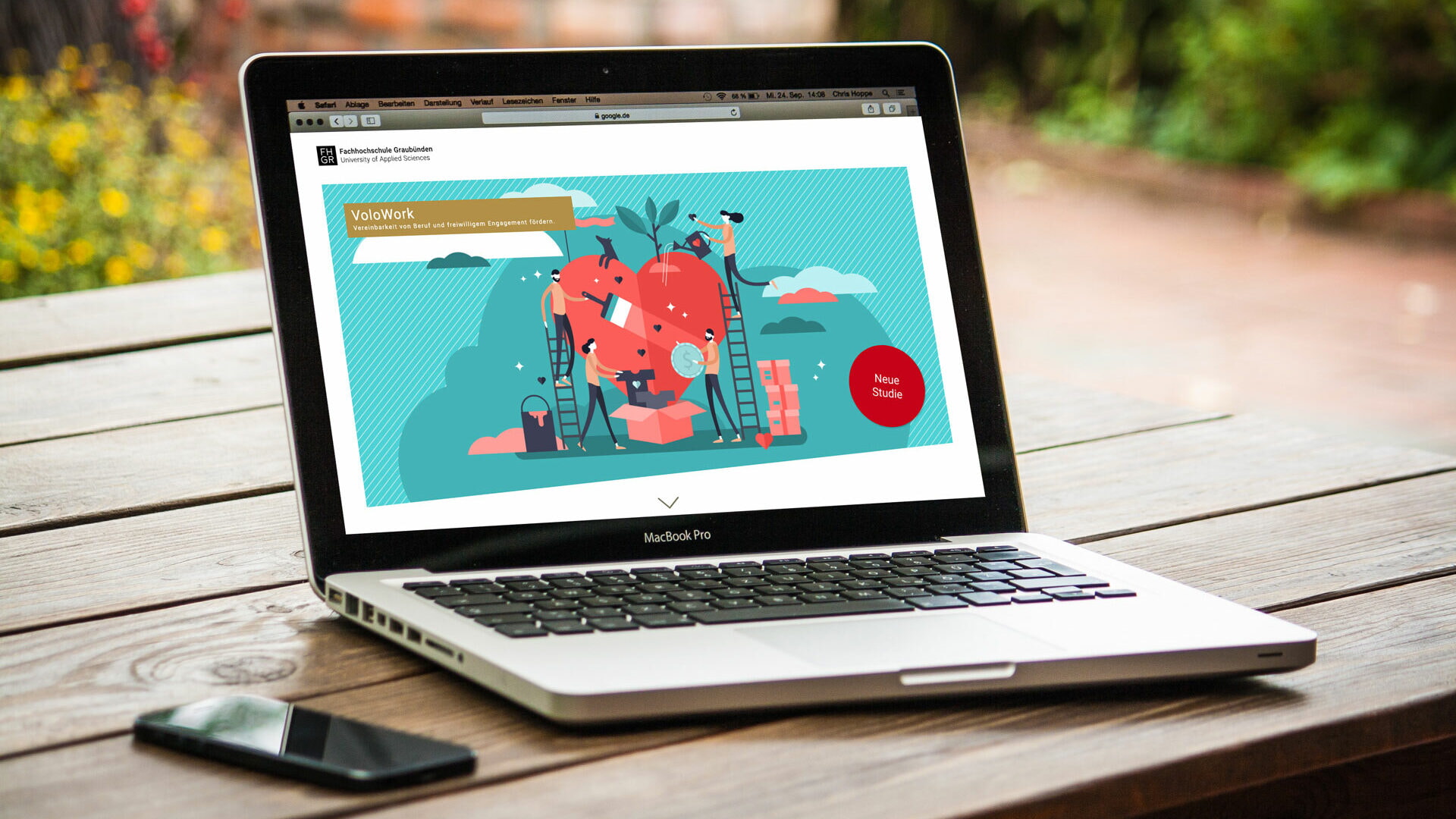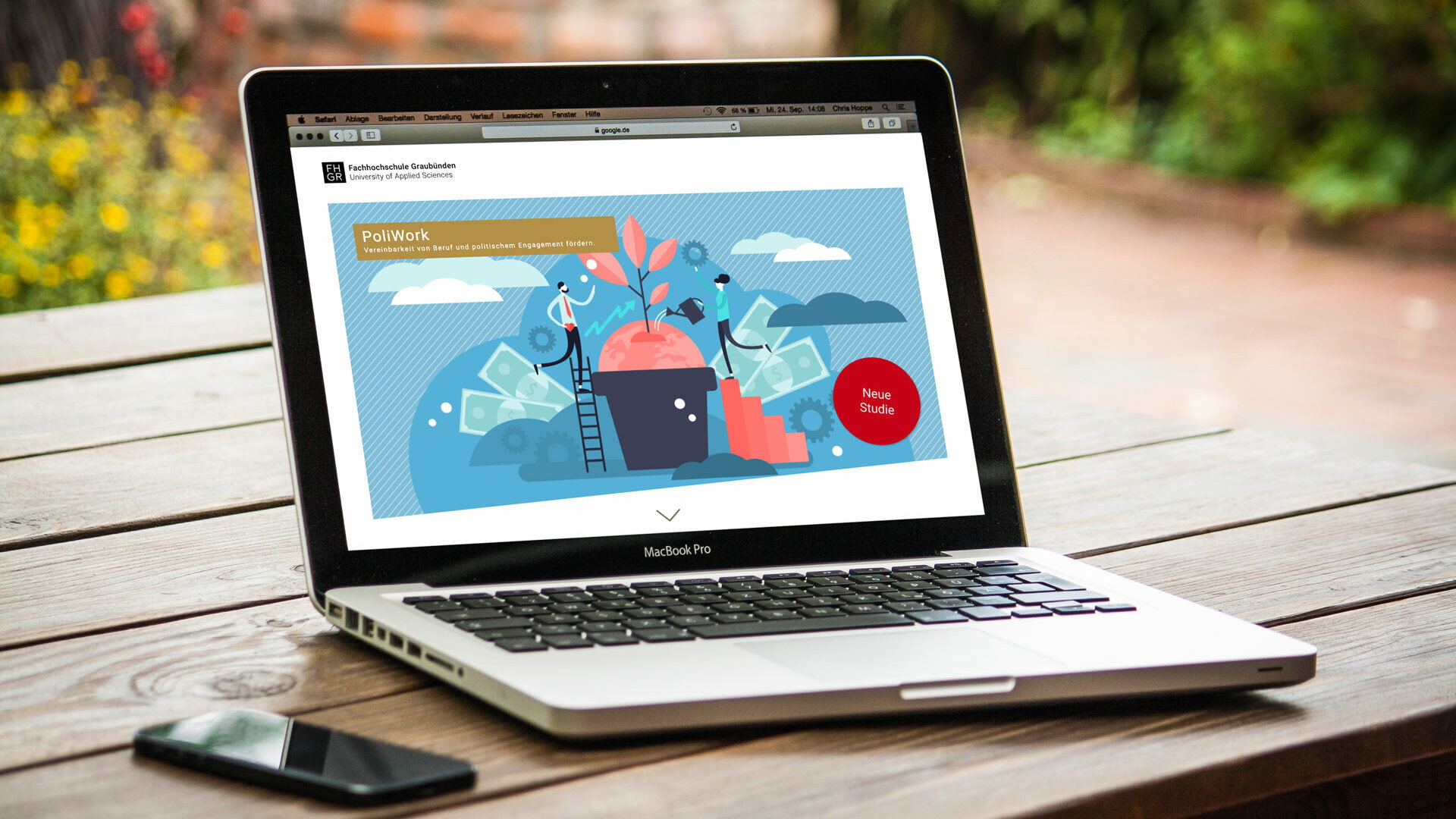In der Schweiz werden jährlich rund 17 Milliarden Stunden Arbeit geleistet. Fast 8 Milliarden Stunden beträgt die bezahlte Erwerbsarbeit. Über 9 Milliarden Stunden Arbeit erfolgen unbezahlt. 7 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit leisten wir in Familie und Haushalt und 1, 5 Milliarden Stunden für Care-Arbeit im privaten Umfeld. Gemeinnützige unbezahlte Arbeit jenseits des privaten Umfelds leisten wir entweder als formelle Freiwilligenarbeit in Vereinen und Organisationen (220 Mio. Stunden pro Jahr) oder als informelle Freiwilligenarbeit vorwiegend in der Nachbarschaft (450 Mio. Stunden pro Jahr). Damit die Freiwilligenarbeit in der Schweiz gezielt gefördert werden kann, ist Grundlagenforschung unerlässlich. Die SGG hat seit 2003 rund 30 Forschungsprojekte von Hochschulen in allen Landesteilen begleitet, mitfinanziert und teilweise im Seismo-Verlag publiziert. Die SGG fördert die Erforschung von Freiwilligenarbeit in der Schweiz auf folgende Weise:
- Erarbeitung des Freiwilligen-Monitors Schweiz (2007, 2010, 2016, 2020, 2025)
- Beauftragung von quantitativen und qualitativen Analysen, bei denen die Daten des Freiwilligen-Monitors sowie weitere Daten verwendet werden können
- Diffusion von Freiwilligenforschung an der jährlichen Freiwilligen-Tagung, auf mehreren Webseiten, in E-Books und anderen Publikationsformen beim Seismo-Verlag sowie in Social Media
Die SGG wird bei der Förderung von Freiwilligenforschung von der Kommission Forschung Freiwilligkeit (KFF) unterstützt. Dieser gehören folgende Personen aus Wissenschaft und Praxis an:
- Prof. Dr. Peter Farago (Präsident), Gründungsdirektor FORS i.R., Zürich
- Dr. Jeannette Behringer, Forum Demokratie & Ethik, Zürich
- Prof. Dr. Sandro Cattacin, Département de sociologie, Université de Genève
- Cornelia Hürzeler, Direktion Gesellschaft & Kultur, Migros-Genossenschafts-Bund MGB, Zürich
- Dr. Markus Lamprecht, Lamprecht & Stamm Sozialforschung und Beratung, Zürich
- Nicole Schöbi, Bundesamt für Statistik BFS, Neuchâtel
- Paola Solcà, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI, Manno
- Prof. Dr. Christian Staerklé, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
- Prof. Dr. Muriel Surdez, Département des sciences sociales, Université de Fribourg
Unterstützte Forschungsprojekte (Auswahl)
Die SGG hat seit 2003 zahlreiche Forschungsprojekte finanziell unterstützt und begleitet. Einige Forschungsarbeiten wurden in der Reihe «Freiwilligkeit» im Seismo Verlag herausgegeben.
Weitere Studien (Auswahl)
Richard Traunmüller, Isabelle Stadelmann-Steffen, Kathrin Ackermann, Markus Freitag Zivilgesellschaft in der Schweiz. Analysen zum Vereinsengagement auf lokaler Ebene. 2012, 240 Seiten, ISBN 978-3-03777-113-6.
Präsentation Prof. Markus Freitag, Januar 2013
Doris Aregger: Dissertation „Freiwillig Engagierte – Engagierte Freiwillige. Wer sind die Schweizer Freiwilligen und was leisten sie? Eine empirische Analyse der Determinanten der Freiwilligenarbeit in der Schweiz PDF
Romualdo Ramos / Theo Wehner u.a.: Busy Yet Socially Engaged: Volunteering, Work–Life Balance and Health in the Working Population PDF
Lukas Scherer / Daniel Jordan: Workshop der GGKS: Wie gewinnen wir neue Freiwillige? Wie verbessern wir unsere öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung? PDF
Daniel Jordan / Alexandra Cloots: Quantitative Analyse der regulatorischen Vorschriften bei den gemeinnützigen Organisationen im Kanton St. Gallen PDF
Freiwilligen-Management und Freiwilligen-Koordination
An der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten existiert der CAS-Lehrgang in Freiwilligen-Management. Eine mit Bestnote bewertete Schlussarbeit thematisiert das Freiwilligen-Management und die Freiwilligen-Koordination in Institutionen. Die Autorin wirkt als Freiwilligen-Koordinatorin und Leiterin Aktivierung und Alltagsgestaltung in zwei Betagtenzentren in der Zentralschweiz. Die Erkenntnisse aus den Betagtenzentren sind durchaus übertragbar auf Betreuungsinstitutionen im Kinder-, Jugend- oder Gesundheitsbereich sowie auf NGOs im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich.
Quellenangabe: Karin Blum: Freiwilligen-Management und Freiwilligen-Koordination in Betagtenzentren. Projektarbeit im CAS-Lehrgang „Freiwilligenmanagement“. Olten, FHNW, 2018.
Neuer Gesellschaftsvertrag
Die Autorenzeitschrift „schweizer monat“ thematisiert seit 1921 politische und gesellschaftliche Zeitfragen. Regelmässig gibt die Redaktion auch thematische Sondernummern heraus: im Oktober 2015 eine über das freiwillige Engagement in der Zivilgesellschaft. Die Schweiz ist diesbezüglich wie in manch anderen Bereichen ein Sonderfall: Das Land verfügt über ein vom Staat gefordertes und gefördertes Milizprinzip. Und gleichzeitig engagieren sich die Bewohnerinnen und Bewohner landesweit als Freiwillige in über 100’000 Vereinen sowie in der Nachbarschaft. Und das Stiftungswesen sowie die Spendenbereitschaft blühen ebenfalls. Die Artikel des Spezialheftes informieren über die zivilgesellschaftlichen Trends und wollen die Lesenden gleichzeitig sensibilisieren und ermutigen für ein gemeinnütziges Engagement.
Die Artikel und Interview-Inputs stammen von Barbara Bleisch, Monique Bär, Peter Sloterdijk, Markus Freitag und Lukas Niederberger.
René Scheu (Hrsg)
Blühende Zivilgesellschaft. Vom Wert des freiwilligen Engagements
Autorenmagazin „Schweizer Monat“, Sonderthema 25
SMH Verlag, Zürich 2015, 32 Seiten, ISSN 0036-7400
Die Kooperation von Gemeinden und Vereinen
Eine Kosten-Nutzen-Analyse in zehn Schweizer Gemeinden
Die Kosten-Nutzen-Studie des Migros-Kulturprozent in zehn ausgewählten Deutschschweizer Gemeinden zeigt, dass sich die Kooperation zwischen Gemeinden und Vereinen auch betriebswirtschaftlich lohnt.
Gemeinden brauchen Vereine und Vereine brauchen Gemeinden. Viele Untersuchungen zeigen auf, wie erfolgreich die Zusammenarbeit von Gemeinden und Vereinen gestaltet werden kann. Die vom Migros-Kulturprozent in Auftrag gegebene und von Prognos durchgeführte Studie untersucht erstmalig den Nutzen, welchen Vereine für ihre Gemeinden erbringen und versucht diesen anhand von Fallstudien zu quantifizieren. Papierversion bestellen
Herausgeberin:
Cornelia Hürzeler, Migros-Kulturprozent
Weitere Materialien zum Thema Gemeinden und ihre Vereine finden Sie hier.
Verfasser der Studie:
Marcel Hölterhoff
Die Firma Prognos AG hat die Studie im Auftrag des Migros-Kulturprozent verfasst.