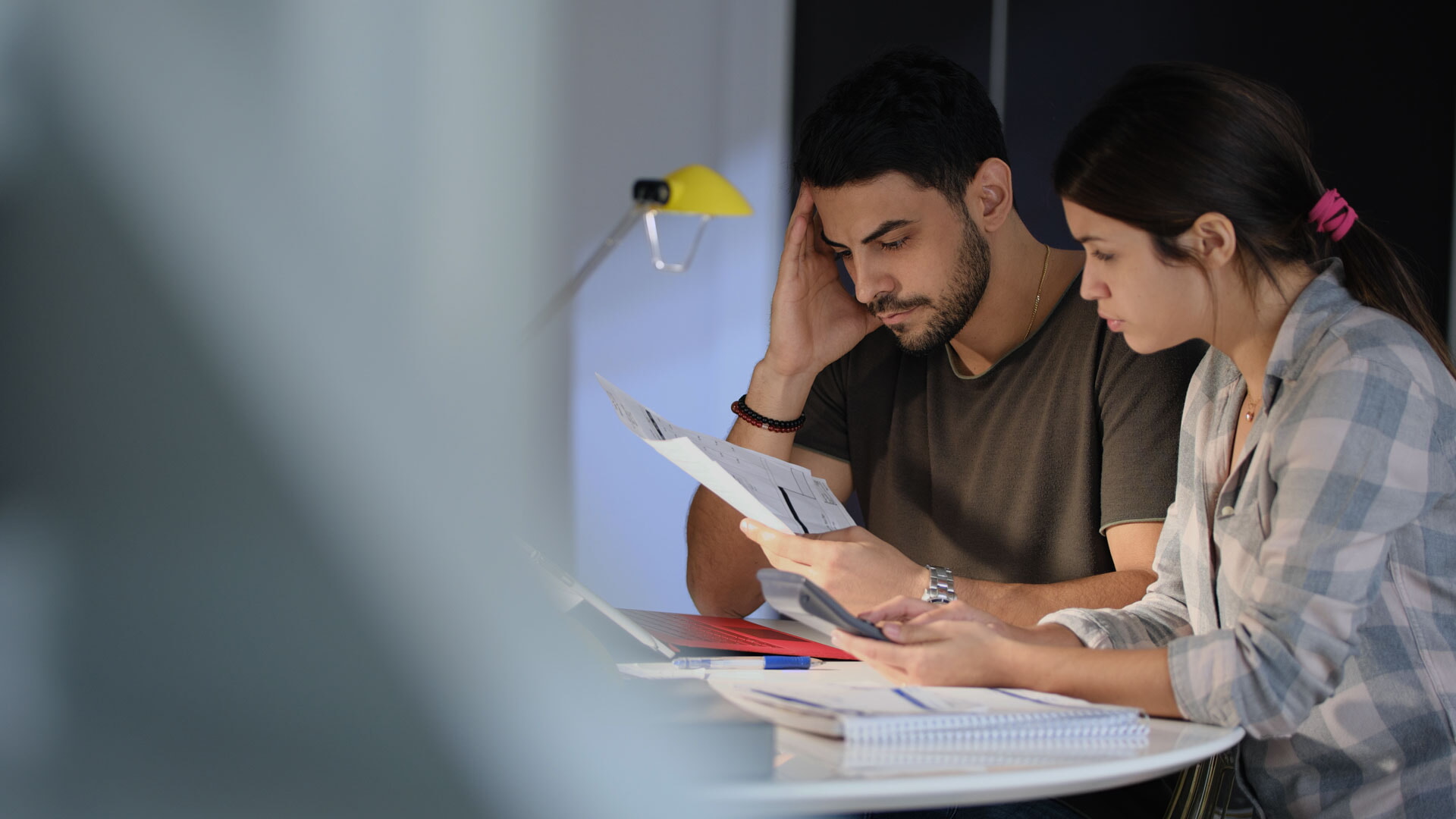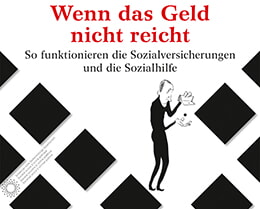Markus Kaufmann
Geschäftsführer der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS
Markus Kaufmann
Geschäftsführer der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS
«Die Einzelfallhilfe von privaten Förderorganisationen wie der SGG soll und kann die staatliche Sozialhilfe nicht entlasten oder ersetzen. Sie ist eine wichtige Ergänzung, da sie in spezifischen Situationen einen grösseren Handlungsspielraum hat.»
Im Corona-Jahr 2020 hat die SGG in der Hilfe für Armutsbetroffene erneut das Kostendach von einer halben Million Franken erreicht. Eine Kostenexplosion ist im Jahr 2022 zu erwarten, wenn Corona-bedingte Stellenlose ausgesteuert werden und in der Sozialhilfe landen. Das neue Ausländerrecht hat dazu geführt, dass immer mehr armutsbetroffene Familien ohne Schweizerpass auf Sozialhilfe verzichten, um eine Ausweisung zu vermeiden. Neben fragwürdiger Paragrafenreiterei in kommunalen Sozialstellen führte das Corona-Jahr auch zu überraschenden Zeichen der Solidarität.
Lockdown … und tschüss
Bei der SGG hat die Anzahl Gesuche im Bereich der Einzelhilfe in den letzten Jahren konstant zugenommen. Im Berichtsjahr 2020 nahmen die Gesuche gegenüber dem Vorjahr um 15% zu. Das hängt mit drei Faktoren zusammen. Erstens hat der politische Druck auf kommunale Sozialfachstellen weiter zugenommen. Immer mehr Gemeinden betreiben eine Negativ-Konkurrenz, indem sie mit einer restriktiven Haltung gegenüber Armutsbetroffenen von sich reden machen. Bei zahlreichen Gemeinden liegt in der Sozialhilfe der Grundbetrag für Personen mit F-Ausweis 30% unter den SKOS-Richtlinien, was eine gesellschaftliche Teilhabe absolut verunmöglicht. Zweitens gelangten im Jahr 2020 besonders viele Armutsbetroffene direkt an die SGG und an andere private Förderorganisationen, weil sich in der Romandie und im Tessin mehrere kommunale Sozialfachstellen im Home-Office verschanzten und für Bedürftige während Wochen weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar waren.
Schuldner unerwünscht
Der dritte Grund für die wachsende Zahl von Hilfsgesuchen an private Förderorganisationen liegt darin, dass jede vierte Person, die Anrecht auf Sozialhilfe hätte, bewusst darauf verzichtet. Der Verzicht erfolgt zunehmend aus Angst vor Verlust des politischen Status. Manche Kantone verkünden unverblümt, dass Personen, die Sozialhilfe beantragen, ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren. Personen mit B-Bewilligung und zunehmend auch Personen mit C-Ausweis werden ab einem bestimmten Betrag bezogener Sozialhilfe dem SEM gemeldet. Manche Working Poor machen darum Schulden, bis es gar nicht mehr geht. Allerdings sind auch Schulden von Personen mit Ausweis B oder C ein Grund, weshalb der Staat ihre Aufenthaltsbewilligung nicht mehr verlängert.
Fehlende Nachhaltigkeit
Die SGG erhält seit einigen Jahren zunehmend Unterstützungsgesuche für Aus- und Weiterbildungen. Dadurch erhöhen Stellenlose ihre Chance auf einen Arbeitsplatz. Die Ausbildung des SRK für Pflegeassistenz trägt stark dazu bei, dass Personen aus der Arbeitslosigkeit und folglich aus der Sozialhilfe finden. Andere Sozialhilfe-Beziehende finden dank Führerschein für Pkw, Bus oder Lastwagen eine Arbeitsstelle. Umso schmerzlicher ist es, wenn kommunale Sozialdienste in Gesuchen den Erwerb eines Führerscheins zwar als zwingend notwendig erachten, damit der Klient von der Sozialhilfe abgelöst werden kann, sich aber gleichzeitig weigern, einen Kostenbeitrag zu leisten. Viele Gemeinden zahlen lieber längerfristig Sozialhilfe statt einmalig zwei- bis dreitausend Franken in Bildungsmassnahmen zu investieren.
Erfreuliche Beispiele…
Ein junger Anwalt setzt sich beispielsweise kostenlos für den in finanzielle Not geratenen P. ein. Nach einer schwierigen Kindheit und Jugend hielt sich P. mit Gelegenheitsjobs über Wasser, wurde arbeitslos und beantragte Sozialhilfe. Der Schuldenberg wuchs und die Motivation, sein Leben in den Griff zu bekommen, sank. Der Anwalt übernahm ein Beistandsmandat auf freiwilliger Basis, erstellte einen Sanierungsplan, verhandelte mit Gläubigern und überwachte akribisch die Ausgaben des jungen Mannes. Über eine Sozialstelle erhielt die SGG ein Gesuch für die Übernahme von Krankenkassenausständen, die nicht in das Entschuldungsverfahren eingeschlossen werden konnten. In der Zwischenzeit hat P. wieder Mut gefasst und eine Arbeitsstelle gefunden, bezahlt regelmässig seine Abzahlungsraten und die laufenden Kosten. Längerfristig will er seine unterbrochene berufliche Ausbildung wieder aufnehmen.
… und andere auch
Eine 61-jährige Grossmutter erhielt im Sommer 2020 von einer Walliser Gemeinde das amtliche Sorgerecht für ihre 6 Enkelkinder im Alter von 13, 12, 10, 8, 5 und 2 Jahren, weil die Kindesmutter psychisch nicht mehr in der Lage war für ihre Kinder zu sorgen. Da die Platzierung der Kinder notfallmässig erfolgte, bekam die Grossmutter kein Pflegegeld, sondern nur den Grundbedarf der Sozialhilfe für die 6 Kinder. Für die Grossmutter war es unmöglich, diese Aufgabe ohne Auto wahrzunehmen. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig. Das Sozialamt weigerte sich jedoch, der Grossmutter die nötigen CHF 3 000.— für den Kauf eines Gebrauchtwagens zu entrichten und verlangte, dass das Auto über Stiftungsgelder zu finanzieren sei. Die SGG kam für den Kauf des Fahrzeugs auf, so dass die Grossmutter ihre 50%—Tätigkeit bei der Spitex mit der Sorge für die sechs Enkelkinder verbinden konnte.
Die SGG kann diese effektive und effiziente Hilfe aber nur leisten, weil viele Menschen der SGG Spenden oder Legate anvertrauen.