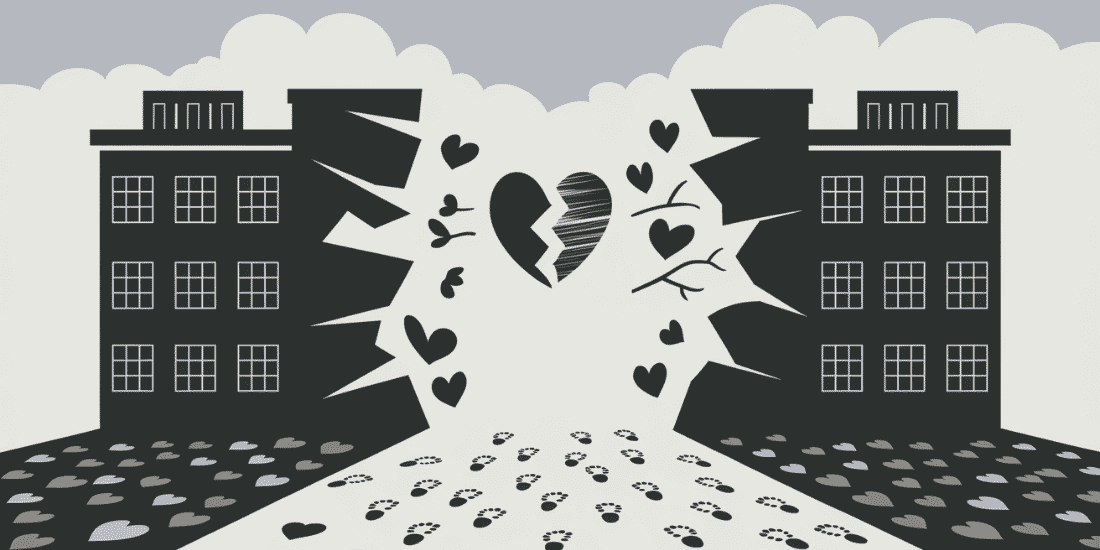11. Februar 2025
Wie Gemeinden verhärtete Konflikte aufbrechen können
Warum braucht es «Lasst uns reden»?
Sarah Friederich: Bei «Lasst uns reden» geht es darum, Menschen mit unterschiedlichen Meinungen wieder ins Gespräch zu bringen. Verschiedene Studien geben Hinweise darauf, dass die gesellschaftliche Polarisierung zunimmt, und viele Menschen haben kaum noch Kontakt zu Andersdenkenden. Doch damit unsere Demokratie gut funktioniert, sind wir darauf angewiesen, dass wir als Gesellschaft mit unterschiedlichen Meinungen umgehen können – und dass wir einen konstruktiven Umgang mit Konflikten finden. Mit «Lasst uns reden» wollen wir ein besseres gegenseitiges Verständnis schaffen und die Demokratiekompetenzen stärken.
Lea Suter: Uns ist es wichtig, Lücken in unserer Demokratie zu schliessen. Während Volksabstimmungen und Gemeindeversammlungen wichtige Instrumente sind, fehlt es oft an Formaten für echten Dialog. Wir ergänzen diese bestehenden Methoden durch Angebote, die Menschen befähigen, konstruktiv miteinander zu sprechen.
Sie sind im Gespräch mit verschiedenen Pilotgemeinden, die sich überlegen, angesichts verhärteter Fronten externe Unterstützung zu holen. Welche Herausforderungen stehen dort im Mittelpunkt?
Lea Suter: In einer Gemeinde stehen Konflikte um die Nutzung der Altstadt im Fokus. Unterschiedliche Interessen – von Anwohnenden, Gewerbetreibenden, Gästen und dem Denkmalschutz – führen zu Spannungen. Es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem Verständnis für unterschiedliche Bedürfnisse entsteht und Wege für eine konstruktive Zusammenarbeit gefunden werden können.
Sarah Friederich: In anderen Fällen sind die Streitpunkte Windräder oder konkrete lokale Bauvorhaben – Themen, bei denen unterschiedliche Gruppen stark abweichende Interessen haben.

Sarah Friederich
Co-Projektleiterin «Lasst uns reden»
Sarah Friederich
Co-Projektleiterin «Lasst uns reden»
«Menschen sind oft bereit zu sprechen, wenn sie wissen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden.»
Was zeichnet «Lasst uns reden» aus?
Sarah Friederich: Unser Ansatz ist, bereits eskalierte Konflikte durch einen Prozess basierend auf Methoden aus der Mediation und Dialogarbeit wieder auf eine Ebene zurückzubringen, auf der mehr Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen und Bedürfnisse entstehen kann und wieder ein konstruktives Gespräch möglich wird. Wir führen eine Konfliktanalyse durch, sprechen mit allen Beteiligten und stellen sicher, dass alle relevanten Perspektiven im Dialogprozess vertreten sind. So wird der Austausch fair und ausgewogen gestaltet.
Lea Suter: Ein grosser Unterschied zu öffentlichen Veranstaltungen ist, dass wir genau darauf achten, wer am Dialog teilnimmt. Die Gruppen werden gezielt zusammengesetzt, sodass alle wesentlichen Positionen vertreten sind. Das ist entscheidend, damit der Prozess als legitim empfunden wird.
Wie läuft denn ein Dialogprozess konkret ab?
Sarah Friederich: Es gibt keinen vorgefertigten Bausatz, der immer gleich ist. Zuerst analysieren wir den Kontext und sprechen mit den Konfliktparteien. Auf dieser Basis entwickeln wir massgeschneiderte Workshops, die von erfahrenen Moderatorinnen geleitet werden. Der Dialog bietet einen sicheren Raum, in dem sich Menschen gehört fühlen – ohne sofort mit Gegenargumenten konfrontiert zu werden.
Ein Beispiel: Nehmen wir an, es soll eine neue Strasse gebaut werden, und es gibt Widerstand. Anwohnende lehnen das Projekt ab, weil sie sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen oder den Lärm fürchten. Die Befürworter sehen hingegen wirtschaftliche Vorteile oder eine bessere Verkehrsanbindung. In unserem Dialogprozess helfen wir den Beteiligten, nicht nur die Positionen, sondern auch die dahinterliegenden Bedürfnisse zu verstehen. Oft zeigt sich, dass es weniger um die Strasse selbst geht, sondern um Themen wie Verkehrssicherheit oder Lebensqualität. Durch diese Perspektiverweiterung können neue Lösungsoptionen entstehen, die die verschiedenen Bedürfnisse berücksichtigen.

Lea Suter
Co-Projektleiterin «Lasst uns reden»
Lea Suter
Co-Projektleiterin «Lasst uns reden»
«Externe Begleitung kann helfen, verhärtete Fronten aufzulösen und einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen.»
Wie schaffen Sie es, Menschen an einen Tisch zu bringen, die eigentlich nicht miteinander reden wollen?
Lea Suter: Wir investieren viel Vorarbeit, um Vertrauen zu schaffen und die Sichtweisen der Beteiligten massgebend in das Design der Veranstaltung einzubeziehen. Wir klären mit allen Gruppen, worum es ihnen geht, und gestalten den Prozess so, dass er für sie sinnvoll erscheint. Niemand wird überstimmt – das sorgt für eine faire Ausgangslage.
Sarah Friederich: Menschen sind oft bereit zu sprechen, wenn sie wissen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Unser Dialogprozess ist darauf ausgerichtet, genau das sicherzustellen.
Was hoffen Sie, dass die Teilnehmenden nach einem solchen Dialogprozess mitnehmen?
Sarah Friederich: Ein besseres Verständnis für die Beweggründe der anderen Seite und die Fähigkeit, konstruktiv weiter an Lösungen zu arbeiten. Oft entstehen auch Empfehlungen für die Gemeinde, die als Grundlage für politische Entscheidungen dienen können.
Ihr Projekt läuft in einer Pilotphase. Was passiert danach?
Sarah Friederich: Wir evaluieren die Pilotprojekte und möchten «Lasst uns reden» in weiteren Gemeinden etablieren. Unser Ziel ist es, langfristig einen Beitrag zu einem konstruktiven Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten zu leisten.
Welche Botschaft möchten Sie Gemeinden oder Städten mitgeben, die überlegen, sich auf einen Dialogprozess einzulassen?
Lea Suter: Konflikte sind normal, sie können sogar befruchtend sein. Aber sie müssen nicht eskalieren. Externe Begleitung kann helfen, verhärtete Fronten aufzulösen und einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen. Das stärkt nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch die politische Handlungsfähigkeit der Gemeinde.
In Kürze: Das ist «Lasst uns reden»
«Lasst uns reden» ist ein strukturiertes Dialogangebot von Pro Futuris, dem Think + Do Thank der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG). Es unterstützt Gemeinden dabei, verhärtete Konflikte zu entschärfen und das gegenseitige Verständnis zu stärken. Die Dialog-Workshops basieren auf Methoden aus Mediation und Moderation und werden gemeinsam mit der Gemeinde entwickelt. Ziel ist es nicht, sofortige Lösungen zu finden, sondern eine Gesprächsbasis zu schaffen, auf der weitere politische Prozesse aufbauen können. Das Angebot richtet sich an Gemeinden, die Konflikte innerhalb der Bevölkerung konstruktiv bearbeiten wollen. In der Pilotphase werden 85 Prozent der Kosten durch die SGG, 3FO und Migros übernommen.